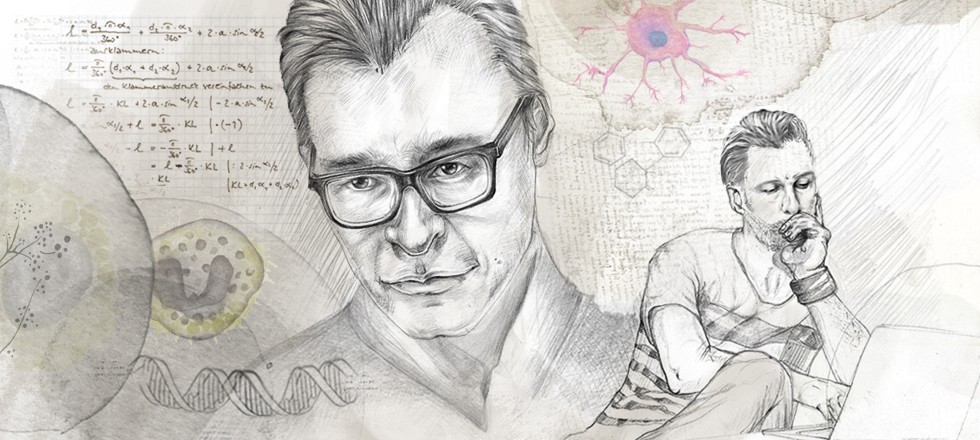Wissenschaftsjournalismus: „Spaß an Prozessen“
Interview mit dem freien Wissenschaftsjournalisten Rainer Kurlemann
Was kennzeichnet das Fachressort Wissenschaft? Rainer Kurlemann muss es wissen – denn er ist ein Veteran des Wissenschaftsjournalismus. Seinen ersten Leitartikel schrieb er 2001 über die Entschlüsselung der menschlichen DNA. Der Fachjournalist wirft ein Schlaglicht auf Kurlemanns Metier und sprach mit ihm über den „Sendung mit der Maus“-Effekt und das Problem der „Ankündigungswissenschaft“.
Herr Kurlemann, Sie selbst haben einst über die Herstellung von komplexen Goldverbindungen mithilfe der Elektrochemie promoviert. Braucht man ein naturwissenschaftliches Studium als Rüstzeug für den Job als Wissenschaftsjournalist?
Nicht unbedingt. Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist ein hohes Interesse an Themen aus Physik, Biologie oder Chemie, denn man muss sich in vieles intensiv einarbeiten – das musste ich auch. Ich bin Chemiker, schreibe aber viel über Themen aus den Bereichen Gesundheit, Stammzellforschung oder Genetik.
Welchem Missverständnis begegnen Sie denn am häufigsten, wenn es um Ihr Metier geht?
Im Small Talk bei Veranstaltungen heißt es oft: „Oh, Sie sind Wissenschaftsjournalist, da müssen Sie aber Dinge gut erklären können.“ Wenn diese Fähigkeit die wichtigste wäre, dann wäre die „Sendung mit der Maus“ der beste Journalismus. Aber was den Spaß und Wert meiner Arbeit ausmacht, ist das Überprüfen von Behauptungen, die Schilderung der Auswirkungen, das Erklären von Prozessen.
„Spaß an Prozessen“ – das hört sich nach PR-Deutsch an …
Ist es aber nicht! Nehmen wir das Beispiel Ebola. Ich kann den Lesern aufzeigen, wie das Virus im menschlichen Körper wirkt. Aber das ist nur die Basis, auf der ein Wissenschaftsjournalist die von der Krankheit angestoßenen Prozesse analysiert. Also beispielsweise recherchiert, welcher Impfstoff besonders aussichtsreich ist, da spielen neben der Wirksamkeit oft politische oder wirtschaftliche Interessen ebenfalls eine große Rolle.
Stichwort Interessen: Welche Auswirkung hat die Verquickung von Wissenschaft und Wirtschaft für ihr Metier?
Konkret für die Arbeit ergibt sich das Problem der „Ankündigungswissenschaft“. Damit ist Folgendes gemeint: Mit der Globalisierung wird der Wettbewerb in den Wissenschaften immer härter. Um sich für Forschungsgelder zu positionieren, muss ständig Aufmerksamkeit erzeugt werden – das kann die Ankündigung eines Durchbruchs sein oder eine viel zu weit gehende Interpretation, was durch das Forschungsergebnis möglich sein wird. Wenn Forscher beispielsweise berichten, dass sie mit Bio-Printing durch einen speziellen 3D-Drucker aus Körperzellen eine Leber erzeugt haben. In Wirklichkeit hat das Gewebe zwar die Form einer Leber, es fehlt aber jegliche Blutzirkulation. Damit ist das Ding nicht lebensfähig.
Früher veröffentlichte der Forscher seine Arbeit in einem Fachjournal. Dann folgte eine Fachdebatte, irgendwann sickerte das Thema in die Öffentlichkeit. Das geht heute viel schneller, auch durch Social Media oder die PR-Arbeit der Presseabteilungen, über die inzwischen alle Forschungseinrichtungen verfügen.
Sehen Sie Social Media dann eher als Störfaktor für ihre Recherche?
Im Gegenteil. Wie so oft, muss man die Spreu vom Weizen trennen, das gilt für Wissenschafts-PR ganz allgemein. Dafür ist es heute viel einfacher, sich ein umfassendes Meinungsbild zu einem Thema zu verschaffen als noch vor 20 Jahren, als ich als Journalist angefangen habe.
Von den Social-Media-Tools verwende ich am liebsten Twitter. Damit verfolge ich für mich relevante News und Meinungen in der Wissenschafts-Community. Diese Community ist mitteilungsfreudiger, als manche vielleicht denken, es könnten sich aber noch mehr Forscher beteiligen.
Wie sieht denn der Arbeitstag des Wissenschaftsjournalisten Kurlemann aus?
Schwierig zu sagen; eigentlich ist jeder Tag anders. Es gibt Tage, an denen muss ich viel Schreiben. Ich nehme mir aber viel Zeit für Recherche. Es kann sein, dass ich einen ganzen Tag die wichtigsten Magazine und Blogs lese, um nach neuen Themen zu stöbern oder meine Kenntnisse zu vertiefen. Außerdem besuche ich gern Vorträge und Fachtagungen, rede oder maile mit Wissenschaftlern. Das ist immens wichtig, um Forschungsergebnisse bewerten zu können. Gerade das Reflektieren mit Gesprächspartnern ist bei den komplexen Wissenschaftsthemen wichtig, um ein klares Bild zu bekommen.
Kommunikation ist für jeden Journalisten das A und O, aber vielleicht ist gerade die Intensität der Fachgespräche ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für den Wissenschaftsjournalismus. Für den Austausch mit Kollegen habe ich noch meine informellen Zirkel und bin Mitglied im Fachverband für Wissenschaftsjournalisten, der Wissenschaftspressekonferenz.
Sie erwähnten Blogs, welche lesen Sie?
Eines meiner Haupthemen ist die Genetik. Da finde ich „transgen“ spannend oder den Blog des Genforschers Francis Collins. „transgen“ bietet einen breiten Überblick zur Gendebatte in Deutschland. Collins ist Direktor der nationalen Gesundheitsinstitute der USA und liefert Hintergründe zur Medizinforschung im Wissenschaftsland USA, wo es spannende Projekte gibt. Sehr beliebte Plattformen für Wissenschaftsblogger sind „Scilogs“ und „Scienceblogs„.
Aber trotz der wachsenden Bedeutung von Social Media: Die klassischen Fachzeitschriften sind für jeden Wissenschaftsjournalisten weiterhin ein Muss, um den Debatten folgen zu können. Das sind vor allem „Science“ und „Nature„, oder in Deutschland „Spektrum der Wissenschaft„. Gut gemacht finde ich das ganz neue Magazin „Substanz„. Das gibt es erst seit ein paar Monaten als ein neues Projekt von Journalisten und kommt nur online heraus.
Apropos Jung-Journalisten: Würden Sie denen den Einstieg in den Wissenschaftsjournalismus empfehlen?
Das ist ein schwieriges Gebiet, aber ich denke schon, dass man das empfehlen kann. Auch deshalb, weil sich die Einstellung der Menschen zur Wissenschaft in einer Form ändert, dass wir Journalisten davon profitieren.
Wenn heute ein Wissenschaftsthema aufkommt, dann will die Bevölkerung umfassend informiert werden. Was ist wissenschaftlich gesichert? Wie viel wird das kosten? Wer profitiert davon am meisten? Die Menschen wollen wissen, wie alltagstauglich Innovationen für sie sind. Dadurch gibt es für mich neue Auftraggeber. Gerade habe ich von einem Frauenmagazin den Auftrag erhalten, für sie ein Stück zu den Auswirkungen von Botox zu recherchieren. Jungen Journalisten kann ich ein spezielles Arbeitsfeld empfehlen: den Datenjournalismus. Hier werden Daten nach journalistischen Fragestellungen ausgewertet. Das hat ein sehr großes Potenzial.
Wie funktioniert denn ihr Geschäftsmodell?
Bei mir sieht das noch sehr klassisch aus. Etwa die Hälfte verdiene ich mit Printartikeln, für die ich angefragt werde. Das sind ganz unterschiedliche Magazine und Fachzeitschriften, aber auch Tageszeitungen, auch wenn die schlechter zahlen. Die anderen 50 Prozent kommen über Akquise meinerseits. Hier suche ich Magazine, die sich für Wissenschaftsthemen interessieren oder wo diese Themen ins Blatt passen. Den Bereich Corporate Publishing oder Wissenschafts-PR versuche ich so gering wie möglich zu halten. Da ist die Versuchung wegen der Honorare manchmal natürlich groß, aber ich lehne auch viel ab. Wenn die Balance nicht stimmt, schadet das irgendwann dem journalistischen Markenkern. Ich bin Journalist und dieser Beruf verlangt eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich PR machen würde.
Zum Schluss: Welche Wissenschaftsthemen zu beackern lohnt sich besonders, ihrer Ansicht nach?
Es gibt viele Bereiche, die spannend sind. Ich möchte zwei herausheben: Der eine ist der sich wandelnde Gesundheitsbegriff. Dank Wissenschaft und Technik leben wir immer länger und wissen immer besser über unsere persönlichen Risikofaktoren Bescheid. Die Genforschung wird da noch einiges präsentieren. Die Zusammenhänge zwischen den Genen und dem sozialen Umfeld einerseits und menschlichen Eigenschaften oder der Entstehung von Krankheiten andererseits werden ja gerade erst entdeckt. Dieses Vorwissen und die hohen Kosten, welche die Gesellschaft für das Gesundheitswesen aufwendet, erhöhen aber auch massiv den Druck, seine Gesundheit selbst zu optimieren. Unsere Gesellschaft ist auf diese Debatte noch gar nicht vorbereitet. Sie schafft Chancen, aber gleichzeitig auch Gefahren für den Menschen, die fundierte Analysen vonseiten des Wissenschaftsjournalismus brauchen.
Der zweite wichtige Bereich sind, wie bereits erwähnt, Daten. Wie erfassbar und kontrollierbar wird der Mensch durch die immer besseren Verfahren der Datenerhebung und Auswertung? Welche Fortschritte kann künstliche Intelligenz noch möglich machen? Eine Vorstufe haben wir mit den selbstfahrenden Autos ja schon fast erreicht. Vor zehn Jahren hätte man das als Übertreibung abgetan; heute ist klar, dass es auch in anderen Bereichen so eine Entwicklung geben wird.
Herr Kurlemann, vielen Dank für das Gespräch.
Titelillustration: Esther Schaarhüls
Das Magazin Fachjournalist ist eine Publikation des Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV).
 Rainer Kurlemann (48) hat in Münster in Chemie promoviert und schon während des Studiums für Tageszeitungen geschrieben. Nach einer Zeit als freiberuflicher Journalist ging er zur „Rheinischen Post“ in Düsseldorf. Dort arbeitete er erst in der Politikredaktion und später als Chef vom Dienst am Newsdesk, schrieb über Wissenschaft und leitete als Chefredakteur die Redaktion von RP-Online. Nach 14 Jahren verließ er die Redaktion und konzentriert sich seitdem voll und ganz auf Wissenschaftsjournalismus. Zurzeit schreibt er gerade an einem Buch.
Rainer Kurlemann (48) hat in Münster in Chemie promoviert und schon während des Studiums für Tageszeitungen geschrieben. Nach einer Zeit als freiberuflicher Journalist ging er zur „Rheinischen Post“ in Düsseldorf. Dort arbeitete er erst in der Politikredaktion und später als Chef vom Dienst am Newsdesk, schrieb über Wissenschaft und leitete als Chefredakteur die Redaktion von RP-Online. Nach 14 Jahren verließ er die Redaktion und konzentriert sich seitdem voll und ganz auf Wissenschaftsjournalismus. Zurzeit schreibt er gerade an einem Buch.