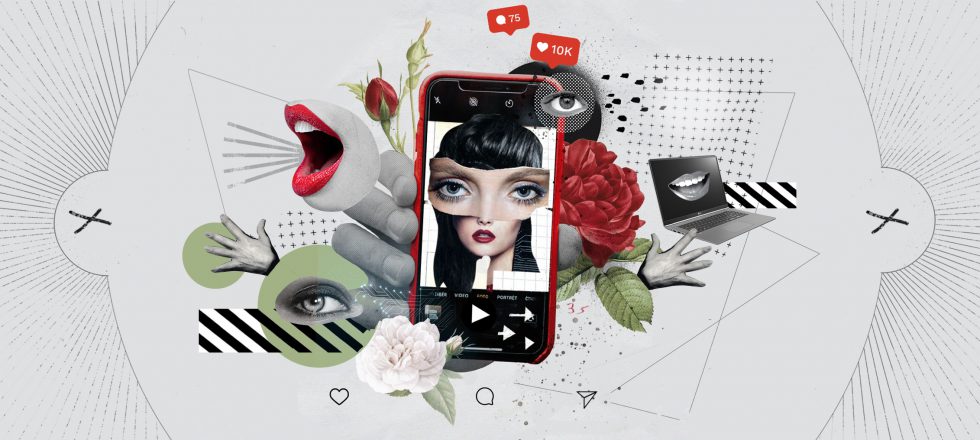„Man sollte den Drang verspüren, sich mitzuteilen“
Rolling Stone ist Kult! In den 1970er-Jahren erregte das Magazin großes Aufsehen mit seinen Titelbildern, beispielsweise Nacktfotos von John Lennon und Yoko Ono oder David Cassidy. Namhafte Fotografen wie Annie Leibovitz, Herb Ritts oder Anton Corbijn sorgen für aufsehenerregende Bilder. Sebastian Zabel leitet die führende Musikmagazin-Marke Deutschlands – und spricht im Interview mit dem Fachjournalist über Objektivität im Kulturjournalismus, Sauforgien mit US-Bands und die Faszination seines Ressorts für Leser und Macher.
Spielen Sie selbst ein Instrument oder singen Sie?
Ab meinem siebten Lebensjahr habe ich Geige gelernt, jeden Tag nach der Schule eine Stunde lang geübt. Mit 14 wollte ich dann doch lieber Punkrocker sein, da passte das nicht wirklich. Heute lege ich gelegentlich als DJ in der Bar eines Freundes auf.
Wie erklären Sie anderen Leuten Ihren Beruf?
Als Musikjournalist bringe ich meine Leidenschaft, die Musik, zusammen mit dem Schreiben, mit dem Sichäußern über Musik. In erster Linie bin ich Journalist. Und in zweiter Linie sehr interessiert an Popkultur und Musik.
Ich war nicht mein Leben lang Musikjournalist. Wobei ich schon als Schüler selbst zusammengeklebte Zeitschriften produziert habe, die sich um Musik drehten, und sie beispielsweise auf Konzerten verkauft habe. Noch während des Studiums hatte ich das Angebot, bei der Musikzeitschrift Spex in Köln als festangestellter Redakteur zu arbeiten. Ich bezog ein kleines Gehalt, was man damals schon toll fand. Wie bei der taz wurde alles ausdiskutiert. Die fünf Jahre in dem Individualisten-Team um Chefredakteur Diedrich Diederichsen, einem der wichtigsten deutschen Poptheoretiker, haben mich sehr geprägt.
Seit 2012 sind Sie Chefredakteur des Kultmagazins Rolling Stone. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Viel unglamouröser, als man sich das gemeinhin so vorstellt. Besucher erwarten immer, dass laute Musik durch die Gänge donnert und auf den Tischen Koks herumliegt. Tatsächlich ist es bei uns relativ aufgeräumt. Wir sitzen in einem Hinterhof in Berlin-Kreuzberg. Ab und zu kommt ein Künstler vorbei, ansonsten ist normaler Redaktionsalltag. Wobei wir auch mal nachts arbeiten. Wenn man Konzerte besucht oder im Clubleben unterwegs ist, ist das ein Teil unserer Arbeit.
Als ich zum Rolling Stone kam, hat sich ein Kreis geschlossen. Aber ich bin froh, dass ich nicht immer als Musikredakteur gearbeitet habe, da ich nicht glaube, dass man eine Sache sein Leben lang machen sollte. Dazwischen habe ich für Tageszeitungen gearbeitet, war zuletzt Vizechef der Berliner Morgenpost, wo ich als Blattmacher Themen festgelegt und Titelseiten gestaltet habe. Da war ein breit gefächertes Interesse gefragt. Jetzt arbeite ich wieder in einem ganz spitzen Bereich, was auch sehr aufregend ist.
Worüber schreiben Sie am liebsten?
Ich mag es, pointiert auf 1.200 Zeichen eine Plattenkritik zu verfassen, zu beschreiben, was ein Song mit dem Hörer macht.
In meinem Vorleben bei Spex fand ich es viel aufregender, wenn ich den Auftrag bekam, nach Manchester zu fliegen, um mit New Order um die Häuser zu ziehen und darüber zu schreiben. Diese Erlebnisse möchte ich nicht missen. Das war natürlich viel reizvoller und auch ergiebiger, als diese 30-Minuten-Hotelzimmer-Interviews.
Ihr persönliches Highlight?
Ich hatte 1995 ein wirklich tolles Interview in Los Angeles mit den Red Hot Chili Peppers, die ich eigentlich gar nicht so toll finde. Es hat sich zu einer Nachtsession ausgewachsen. Es gab einen Stromausfall, wir haben uns die Haare im Hotelpool gewaschen und ich habe Al Green im House Of Blues erlebt, vielleicht das beste Konzert, das ich jemals gesehen habe. Das war als Erlebnispaket große Klasse.
Wie wird man Musikjournalist?
Man kann einfach im Netz loslegen und etwas publizieren. Wenn man aber ein Zertifikat haben will, empfehle ich, ein Volontariat zu machen. Was bei unseren Titeln übrigens auch möglich ist. Oder eine Journalistenschule wie die Axel Springer Akademie zu besuchen.
Was sollte man mitbringen, um in Ihrer Branche zu reüssieren?
So banal das klingt: Man sollte sich sehr für Musik interessieren. Und den Drang verspüren, sich mitzuteilen. Nach dem Motto: „Das ist der beste Song – ich erkläre dir mal, warum das so ist.“ Ein eigener Blick auf die Musik und den Kontext, in dem sie entsteht, ist hilfreich. Und ein eigener Stil. In den Waschzetteln von Plattenfirmen, mit denen ein neues Album angepriesen wird, finden sich oft Floskeln wie: „Er hat sein neues Album im Gepäck.“ Das kann man besser machen.
Was wäre kontraproduktiv?
Sich nicht möglichst breit gefächert auszukennen. Wenn jemand sein Leben lang nur Techno gehört hat und ich schicke den zu einem Heavy-Metal-Konzert – dann wird er Schwierigkeiten haben, darüber etwas Interessantes zu schreiben.
Wie objektiv kann oder muss man sein?
Im Kulturjournalismus ist es noch viel schwieriger als beispielsweise im Politikjournalismus, Objektivität herzustellen. Denn Musik hat viel mit Empfindung und Haltung zu tun, damit, wie sie auf mich wirkt und wie ich zu ihr stehe. Insofern ist es auch nicht immer einfach zu erklären, wieso die eine amerikanische Rockband nun besser sein soll als die andere. Da spielt Erfahrung eine Rolle – und die Haltung des Kritikers.
Ob ich ein Buch lese, eine Ausstellung oder ein Theaterstück sehe oder Musik höre: Wenn ich feuilletonistisch arbeite, fließt meine Position immer mit ein. Ich glaube nicht daran, dass man in unserem Beruf objektiv oder neutral sein kann – ich wüsste nicht, wie. Und ich sehe auch keinen Sinn darin. Musikkritik ist schließlich keine mathematische Lehre.
Der Springer Verlag hat sich von etlichen seiner Titel getrennt. Wie bewerten Sie die Gefahr, dass auch Ihr Magazin verkauft wird?
Davor habe ich keine Angst. Ich glaube, dass sich Axel Springer und die Musiktitel sehr gut ergänzen. Einerseits profitieren wir von den Strukturen des großen Verlages. Andererseits ist es gut, dass der Verlag neben den Flaggschiffen BILD und Welt auch eine Marke im Portfolio hat wie den Rolling Stone, die etwas ganz anderes ausstrahlt.
Obwohl wir eine 100-prozentige Tochter von Axel Springer sind, ist unsere Redaktion ein eigenes kleines Biotop. Wir sind unabhängig, machen, was wir wollen.
Den Musikzeitschriften geht es schlecht. Alteingesessene Zeitschriften wie Spex oder das Hip-Hop-Magazin Juice wurden eingestellt. Rap-Journalismus findet heute fast ausschließlich auf YouTube statt, wo lange Interviews geboten werden, auf Spotify gibt es die Podcasts dazu und auf Soundcloud die Musik. Wie passt sich die Redaktion dem veränderten Nutzungsverhalten an? Gibt es neue Konzepte, um relevant zu bleiben?
Dem Rolling Stone geht es besser als anderen. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass wir über die Jahre hinweg eine sehr treue Leserschaft haben. Magazine, die eher einen newsigen Charakter hatten, sind vom Markt verschwunden. Denn News über Musik kann man in der Tat im Netz finden. Wir setzen auf Hintergrundstücke, tiefere Interviews und Reportagen.
Ich glaube nach wie vor an die Kraft, die Print hat. Wenn man eine große Strecke beispielsweise über die Beatles in Indien hinlegt und die Fotos über eine Doppelseite zieht, erzeugt das ein anderes Gefühl beim Betrachter, als wenn er sich im Internet durch eine Fotogalerie klickt.
Ansonsten müssen wir sparen, wie alle. Es ergibt Sinn, Synergieeffekte zu nutzen. Seit 2019 bin ich zusätzlich Chefredakteur vom Musikexpress, doch wir haben weiterhin getrennte Redaktionen, sind unterschiedlich positioniert. Das geht, sogar sehr gut.
Was ist das Erfolgsrezept des Rolling Stone?
Leute, die sich mit Herzblut damit beschäftigen, wählen Musik aus, bewerten und kontextualisieren sie. Und ordnen popkulturelle Themen meinungsstark ein.
Herbert Grönemeyer hat aktuell im Rolling Stone einen Nachruf auf Andy Gill, den Gitarristen der einflussreichen britischen Post-Punk-Band Gang of Four, geschrieben – das würde er woanders nicht machen. Und darauf bin ich dann auch stolz.
Warum wäre ein Leben ohne Musik für Sie nicht lebenswert?
Diese Frage haben wir kürzlich Sting gestellt. Seine Antwort, mit der ich mich voll und ganz identifiziere: „Das ist, als würde man einen Fisch fragen, wie er ohne Wasser leben kann.“
Titelillustration: Esther Schaarhüls
Das Magazin Fachjournalist ist eine Publikation des Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV).

Fotocredit: Friederike Göckeler
Sebastian Zabel ist seit 2012 Chefredakteur beim ROLLING STONE. Schon früh schrieb er über Musik und brachte Fanzines heraus, Magazine, die von Fans für Fans produziert werden. Das erste Interview führte er mit Mark E. Smith, dem Sänger der englischen Post-Punk-Band The Fall. Den ersten festen Job hatte er beim Musikmagazin Spex. Danach arbeitete er als Reporter, Redakteur, Ressort- und Redaktionsleiter bei verschiedenen Tageszeitungen sowie als DJ in der Bar eines Freundes. „On The Beach“ von Neil Young, „The Modern Dance“ von Pere Ubu und „Channel Orange“ von Frank Ocean gehören zu seinen Lieblingsalben. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.